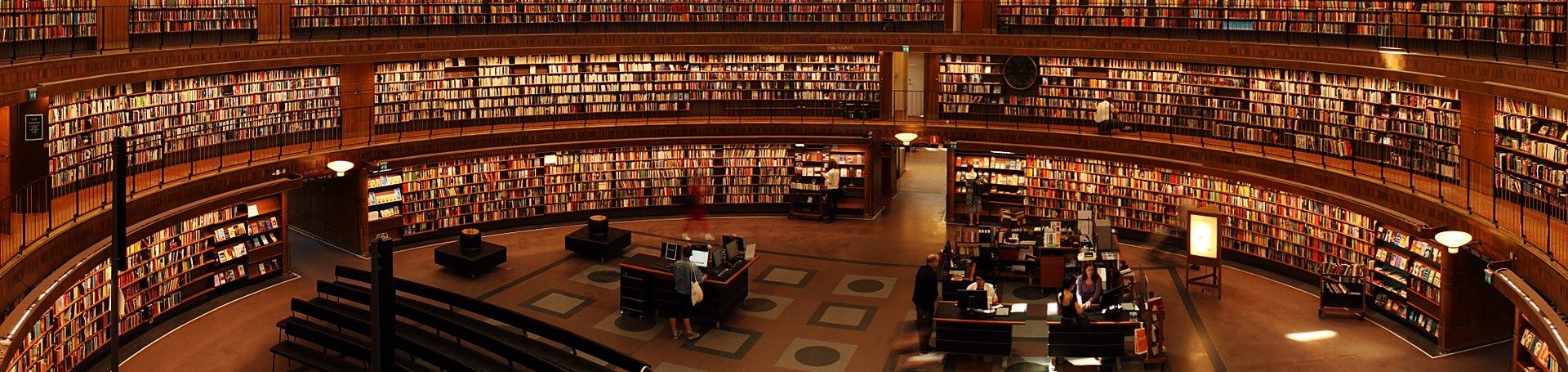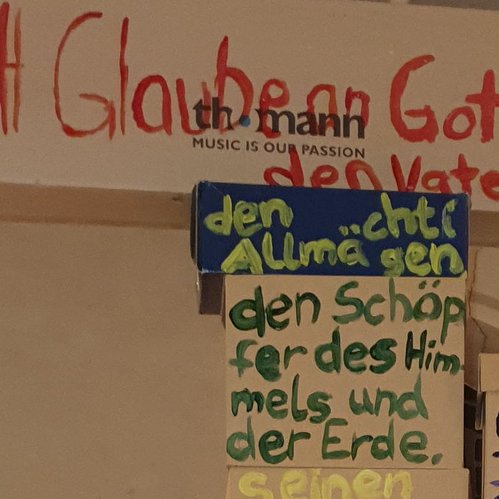Kyrie und Gloria
Die Teile des Gottesdienstes kurz erklärt!
Glockengeläut und Musik zum Eingang eröffnen den Gottesdienst. Dann folgt eine Begrüßung der Gemeinde durch den- oder diejenige, die den Gottesdienst leitet. Ein Gemeindelied wird gesungen.
Bis dahin ist der Gottesdienst für die meisten verständlich. Auch die Worte des Psalms zu hören bzw. sie mitzusprechen ist noch nachvollziehbar. Aber die Gesänge danach verstehen die meisten nicht mehr. Und erst recht nicht, warum sie gesungen werden.
Der gesamte Eingangsteil des Gottesdienstes ist als Hinführung zum Altar, zum Ort, an dem man Gott am nächsten ist, zu verstehen. Jeder und jede geht diesen Weg für sich.
Beim Sprechen des Psalms und dem folgenden Gloria Patri (aus dem Lateinischen: Ehre sei dem Vater) befindet man sich ganz am Eingang der Kirche. Gott zu loben und ihm die Ehre zu geben, das soll am Beginn des Gottesdienstes stehen, denn er ist der Schöpfer, dem ich das Leben und diese Welt zu verdanken habe. Das Gloria Patri ist zugleich ein Bekenntnis zum dreieinigen Gott, Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist. Hier wird klar, auf wen ich mein Leben richte und auch meinen Blick im Gottesdienst.
Nach dem Gloria Patri folgt das Kyrie eleison (aus dem Griechischen: Herr, erbarme dich). Ich gehe einen Schritt auf den Altar zu. Das Kyrie bringt zum Ausdruck, dass Menschen ein Gegenüber suchen, das das Menschliche übersteigt. Ich wende mich an Christus, den göttlichen Herrn, der sich meiner erbarmt. Denn kein Mensch ist fehlerfrei und alle bedürfen der Erbarmung Gottes. So Der Herr, der mit dem Kyrie angerufen wird, ist Jesus Christus selbst, der die Welt überwunden hat und für die, die ihm nachfolgen, eintreten wird vor dem himmlischen Richter.
Nun stehe ich als Sünder vor Gott und habe meine Schuld bewusst vor ihm dargelegt und um Erbarmung gebeten. Jetzt trete ich vor den Altar und stimme erneut das Lob Gottes an. Ehre sei Gott in der Höhe (Lateinisch: Gloria in excelsis). Ich tue dies gemeinsam mit den himmlischen Heerscharen bei den Hirten auf dem Felde aus der Weihnachtsgeschichte, zumindest geht der Gesang auf diese Geschichte zurück. Denn hier ist Gott Mensch geworden und hat so alle von ihrer Schuld befreit.
Befreit trete ich nun vor Gott, nachdem ich alles abgelegt habe, was mich von ihm trennt. Dies tue ich gemeinsam mit den anderen Gottesdienstfeiernden im anschließenden Tagesgebet, auch Kollektengebet genannt. Hier sammeln sich alle Individuen zu einer Gemeinschaft und treten gesammelt vor Gott. Nun sind wir bereit das Wort Gottes zu hören, aufzunehmen, und im Anschluss an den Gottesdienst in die Welt zu tragen. Mit dem Gebet wird der erste Gottesdienstteil (genannt: Teil A: Eröffnung und Anrufung) abgeschlossen.
Das Kollektengebet
Wer betet heute noch regelmäßig?
Laut einer Umfrage, die die Zeitschrift IDEA im Januar 2019 veröffentlichte immerhin 45% der Bevölkerung. Vor allem in Dank- und Notsituationen wird gebetet. Dies ist aus meiner Sicht ein erfreulicher Wert, zeigt er doch, dass die Beziehung zwischen Gott und Mensch für viele eine hohe Relevanz hat. Das ist im Übrigen auch der Grund, warum die Kirchen rumstehen und warum wir Gottesdienste feiern: Weil wir diese Beziehung zum Transzendenten, zum Nicht-Sichtbaren, zum Weltschöpfer oder wie es Aristoteles ausdrückte: zum unbewegten Beweger, also zu Gott suchen und sie brauchen. Also beten wir. Immer wieder, mal in 45% der Fälle allein, ansonsten auch in Gruppen z.B. bei Gottesdiensten, Beerdigungen, Taufen, Hochzeiten. Im Fokus dieses Artikels steht ein ganz bestimmtes Gebet. Das sogenannte Tages- oder auch Kollektengebet.
Es kommt nach den liturgischen Gesängen (Gloria Patri, Kyrie, Gloria in excelsis), die im letzten Gemeindebrief beschrieben wurden. Dieses Gebet wird mit „Lasset uns beten!“ eingeleitet. Es gibt Aufzeichnungen, wonach die Gemeinde an dieser Stelle auf die Knie ging, vollständige Stille herrschte und währenddessen alle still zu Gott beten konnten. Dies geschah oft, wie im Bild angedeutet, mit großer Leidenschaft.
Erst nachdem einige Zeit verstrichen war, erhob der Liturg das Wort vom Altar aus und sammelte die Gebete im sogenannten Kollektengebet. (=lateinisch: colligere - sammeln). Da in diesem Gebet auch das Thema des Gottesdienstes mit anklingt, manchmal auch konkret genannt wird, wird es oft auch als Tagesgebet bezeichnet.
Es steht am Ende des Eingangsteils eines jeden Gottesdienstes und schließt ihn ab. Damit ist der symbolische Weg zum Altar abgeschlossen. Wir sind als Gottesdienstgemeinde angekommen, haben zu Gott gebetet und sind nun bereit die biblischen Worte zu hören und sie in der Predigt ausgelegt zu bekommen.
Das Kollektengebet folgt einer Reihe von Regeln, wobei eine theologisch relevant ist, nämlich die des sogenannten Beschlusses: Vielleicht kennen Sie diese Formulierung: „durch unsern Herrn Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir und dem Heiligen Geiste lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit.“ Es ist Kennzeichen dieses Gebets, dass es „durch Jesus Christus“ geschieht. Damit nimmt das Gebet die Verheißung Jesu auf: „Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wenn ihr den Vater um etwas bitten werdet in meinem Namen, wird er’s euch geben.“ (Johannesevangelium 16,23b) Darin besteht die Hoffnung eines jeden Gebetes.
Aber Vorsicht: Ein Gebet ist keine Wünsch-dir-was-Maschine! Dazu aber ein anderes Mal mehr.
Das Glaubensbekenntnis
Sprechen Sie/sprecht Ihr in Ihrem/Eurem persönlichen Umfeld über Ihren/Euren persönlichen Glauben?
Ich habe das Gefühl, dass der eigene Glaube immer mehr zur Privatsache wird. Das ist nicht schlimm, widerspricht aber irgendwie dem, dessen wir uns mit unserer Taufe verpflichtet haben. Denn im Taufbefehl, den wir von Jesus erhalten haben und der bei jeder Taufe der anwesenden Gemeinde zu Gehör gebracht wird, heißt es: "Geht in die ganze Welt: Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und" - jetzt kommt es - "lehrt sie so zu leben, wie ich es euch aufgetragen habe. Und ich versichere euch: Ich bin bei euch an jedem Tag bis die Welt ihr Ende findet." (frei nach Matthäus 28,18-20). Wir sollen also von unserem Glauben erzählen. Von dem, was Jesus in diese Welt gebracht hat und dazu stehen, auch und gerade in aller Öffentlichkeit. Vielleicht fällt das nicht immer leicht. Das merke ich schon daran, wenn ich zu Gesprächen in private Haushalte komme. Als Pfarrerin bekommt man oft als erstes zu hören: "Ich bin ja nicht so oft in der Kirche." Oder: "Mir fällt es schwer zu glauben, wenn ..." Gerade als ob man sich vor der Pfarrerin besonders rechtfertigen müsste. Aber vielleicht ist es auch der Versuch mal Antworten auf schon lange gestellte Fragen zu bekommen, die man sich aber nie getraut hat zu fragen. Ganz egal woran es liegt. Es ist ein Moment, in dem sich zum Glauben geäußert wird. Einer, der einen Schritt in Richtung Auftrag des Taufbefehls tut.
Im Gottesdienst sprechen dann aber doch die allermeisten das Glaubensbekenntnis mit. Vielleicht nicht jeden Satz mit voller Überzeugung. Und manche tun es vielleicht auch nur, weil es dazu gehört. Ganz egal aus welcher Motivation heraus es gesprochen wird, hier legen wir, die Glaubenden, unseren Glauben offen. Dabei folgen wir einer langen Tradition der christlichen Kirche.
Bereits im 4. Jahrhundert gab es fest formulierte Glaubensbekenntnisse, die zunächst Bestandteil der Taufliturgie waren. Daher kommt auch der lateinische Name Credo für das Glaubensbekenntnis. Credo heißt übersetzt "Ich glaube". Dann bekamen sie aber auch Einzug in den agendarischen ("normalen") Gottesdienst. Im 12. Jahrhundert kamen sie in der westlichen Kirche als Abschluss der Lesungen in den Ablauf. An dieser Stelle ist das Glaubensbekenntnis sehr sinnvoll, da es als Antwort auf das gehörte Wort Gottes gesprochen wird. Also hört man erst, was den Glauben ausmacht und wie in ihm gehandelt werden soll und dann sagt man, "Ja, das glaube ich und dazu stehe ich."
Nun sind die ausformulierten Glaubensbekenntnisse, die meist im Gottesdienst gesprochen werden, ja nicht unbedingt die Worte, mit denen wir sonst sprechen und bekennen würden. Aber ich denke, in ihnen ist alles zusammengefasst, was den christlichen Glauben ausmacht. Darüber hinaus gibt es wahrscheinlich noch ganz individuelle Dinge, die den eigenen Glauben prägen und ausmachen. Es wäre spannend mal ein ganz eigenes Glaubensbekenntnis zu schreiben und dann zu sehen, was gleich bleibt und was auch anders ist. Wenn das von vielen aufeinander treffen könnte und dann zum Austausch anstoßen würde, kämen wir dem Auftrag, der uns in der Taufe gegeben ist schon ein ganzes Stück näher. Vielleicht haben Sie/habt Ihr ja mal Lust Ihr/Euer eingenes Glaubensbekenntnis zu formulieren. Nur Mut. Ein Richtig oder Falsch kann es dabei nicht geben, denn jeder und jede bekennt, was ihn/sie überzeugt. Und das kann sich im Laufe eines Lebens auch immer wieder verändern.
Im Gottesdienst vergewissern wir uns mit dem gemeinsam gesprochenen oder gesungenen und fest formulierten Glaubensbekenntnis immer wieder den Grundpfeilern des christlichen Glaubens ganz unabhängig von den individuellen Ergänzungen.
Manchmal wird das Glaubensbekenntnis auch nicht direkt nach den Lesungen gesprochen. Manchmal kommt es auch erst nach der Predigt. Dann, wenn die Auslegung eines biblischen Textes die Relevanz für unser Leben heute deutlich gemacht wurde und unser Glaube gestärkt wurde.
So ist das Glaubensbekenntnis auch öffentliche, Gott lobpreisende Antwort, auf das, was in Gottes Wort offenbar geworden ist - sein Handeln an uns. Bekennen tun wir dabei in vierfacher Weise mit ein und demselben Bekenntnis: nämlich vor uns selbst, vor anderen Christinnen und Christen, vor der Welt und vor Gott.
Ich bin übrigens froh, dass wir unser christliches Bekenntnis öffentlich aussprechen können ohne dafür verfolgt, gepeinigt oder sogar getötet zu werden. Da haben wir viel Glück mit hier in Deutschland. Trauen wir uns also auch dies zu tun und die frohe Botschaft von Jesus Christus zu verbreiten, wie es im Taufbefehl auch gesagt ist, und stehen dazu.